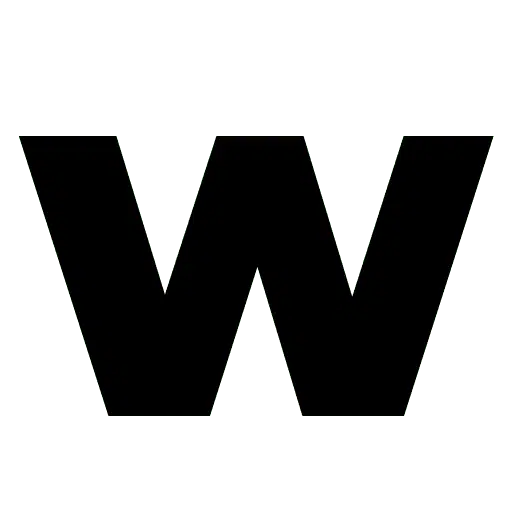Immer wieder ist von Wunderakkus die Rede, die imposante Reichweiten und Ladegeschwindigkeiten versprechen. Doch die Realität ist eine andere. Die Elektrochemie ist viel diffiziler als das Ankündigungspapier geduldig ist. Ein gutes Beispiel sind die Feststoffbatterien, die, wenn man den Prognosen und Versprechungen von diversen Auto- und Nutzfahrzeugbauern glauben durfte, schon im Alltag angekommen sein sollten. Stattdessen werden die Lithium-Ionen-Akkus noch eine ganze Weile das Rückgrat der Stromversorgung für Elektromobile bilden. Um das Ei des Kolumbus der Elektromobilität zu finden, müssen die Forscher viele Parameter unter einen Hut bringen. Eine große Herausforderung. Die schon damit anfängt, das Lastenheft der Stromspeicher zu definieren.
Worauf kommt es bei der Batterie an? Die Kapazität, also die Reichweite bei Langstreckenfahrzeugen? Schnell laden? Oder dass sie günstig ist? Das ist bei Kleinwagen der Fall oder bei stationieren Energiespeichern. Die Aufgabe der Techniker ist es, für jeden Einsatzzweck die perfekte Zusammensetzung der Akkus zu finden. Jede Batterie besteht aus einer Kathode, einer Anode sowie dem Elektrolyten, dass die Ionen von der Kathode zur Anode oder andersherum leitet. Je nachdem, ob die Zelle gerade aufgeladen oder entladen wird. So weit, so klar. Doch jetzt geht die Tüftelarbeit erst los. Um möglichst kompakte Batterien zu erhalten, die in der Regel auch leichter sind, will man die Energiedichte erhöhen, was bei gleichem Bauraum mehr Reichweite verspricht.

„Mit einer Anode aus reinem metallischem Lithium anstelle von Grafit könnten wir in einer gleich großen Zelle ein Vielfaches an Energie speichern“, erklärt Kostiantyn Kravchyk, der bei der Empa (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) nach den Akkus von morgen forscht. Damit wäre als der Jackpot der Elektromobilität gefunden. Reichweitenangst ade! Nicht so schnell! Beim Laden und Entladen der Batterie wird das Lithium nicht gleichmäßig auf und wieder abgetragen. Die Konsequenz ist wenig erfreulich. Es bilden sich sogenannte Dendriten, also verzweigte Strukturen aus metallischem Lithium, die einen Kurzschluss verursachen können.
Ein fester Elektrolyt, wie es in den Festkörper-Akkus verwendet wird, verlangsamt das Wachstum der Dendriten deutlich. Doch jetzt kommt das Schnellladen ins Spiel. Will man Batterien in zehn bis fünfzehn Minuten mit Energie, ist dazu eine hohe Stromdichte (Verhältnis der Stromstärke zur Fläche, durch die der Strom fließt) nötig, die selbst bei Feststoffbatterien Dendriten entstehen lässt. Damit nicht genug. Durch die dabei entstehende ungleichmäßige Ab- und Auftragung von Lithium bilden sich an der Grenze zwischen Elektrode und festem Elektrolyt Hohlräume, die die verfügbare Fläche reduzieren und die Stromdichte noch weiter erhöhen und damit die Gefahr des Dendriten-Wuchers. Ein Teufelskreis.
Die Lösung aus dieser Zwickmühle könnte ein Feststoffelektrolyt aus Lithium-Lanthan-Zirkon-Oxid (LLZO), das eine hohe Ionenleitfähigkeit und chemische Stabilität besitzt – ideale Eigenschaften für den Einsatz in Batterien. „Wir haben LLZO zu einer zweischichtigen Membran verarbeitet, die aus einer dichten und einer porösen Schicht besteht“, verdeutlicht Kravchyk. Diese Struktur stellt schon einen Teil der Lösung dar, Lagert man in den Poren Lithium ein, entsteht eine sehr große Kontaktfläche zwischen dem Lithium und dem Elektrolyten, und die Stromdichte bleibt gering. Die dichte Schicht verhindert zudem, dass keine Dendriten zur anderen Elektrode wachsen. Das Beste kommt zum Schluss: Die Forscher haben ein simples und kostengünstiges Verfahren entwickelt, um diese zweischichtigen Membranen herzustellen.

Doch das ist nicht der einzige Bereich der Energiewende, den die Forscher im Visier haben. Um den Strombedarf zu managen, sind möglichst viele stationäre Speicher nötig. Das können „Second Life“ Akkus sein, also ausrangierte Batterien aus Elektroautos sein. Aber deren teure und seltenen Rohstoffe lassen sich durch immer ausgeklügelteren Recyclingprozessen wiederverwenden. Also lautet die Aufgabe der Forscher, möglichst günstige stationäre Speicher zu entwickeln, die auch im großen Stil eingesetzt werden können und so die relativ ineffizienten Pumpspeicherkraftwerke sukzessive abzulösen, die verglichen mit Batterien eine sehr niedrige Energiedichte haben.
Der Schlüssel zu dieser Herausforderung sind die Materialien. Bei Lithium-Ionen-Akkus besteht die Kathode aus Kobalt und Nickel. Was wäre, wenn man stattdessen Eisen verwendet, das deutlich günstiger ist? Also kombinieren die Techniker die Kathode mit Eisen(III)-hydroxyfluorid. Der Haken an der Sache ist, dass Fluoride eine schlechte Leitfähigkeit für Elektronen und Lithium-Ionen haben. Die Lösung ist einfach und nicht teuer. Die Forscher bringen das Eisen(III)-hydroxyfluorid in eine spezielle Kristallstruktur. Diese sogenannte Pyrochlor-Struktur enthält in ihrem Inneren Gänge, die Lithium-Ionen leiten.
„Wir konnten mit unserer Batterie eine vergleichbare Leistung zu einem deutlich tieferen Preis erzielen“, freut sich Kravchyk und ergänzt: „Wir sind überrascht, dass bis jetzt kaum jemand erforscht hat, wie man dieses vielversprechende Material kostengünstig herstellen könnte.“ Klingt vielversprechend. Jetzt müssen diese Akkus nur noch den Alltagstest bestehen.
TEXT Wolfgang Gomoll