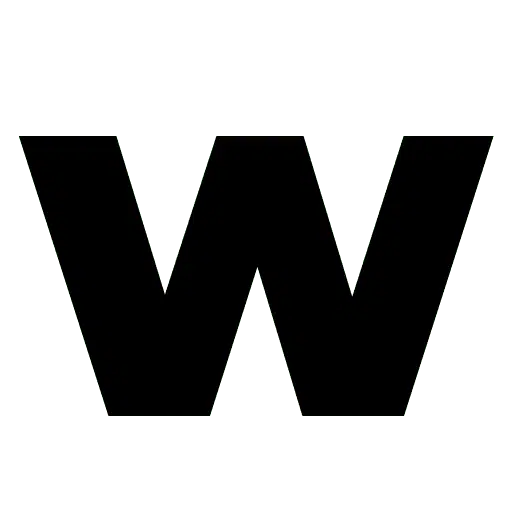Wozu sollte das gut sein? Das Ding war nur drei Meter lang und hatte gerade mal den Hubraum eines ordentlichen Motorrads. 55 PS aus 848 Kubikzentimetern, Topspeed 142 Sachen, ein schlechter Witz. Was dachte sich eigentlich dieser dahergelaufene Halbgrieche, der, noch schlimmer, ein halber Deutscher war?
Besagter Brite mit Migrationsintergrund dachte sich in Zeiten der Suez-Krise und der damit verbundenen Ölknappheit nichts weniger, als den Kleinwagen neu zu erfinden. Und nichts weniger tat er auch. Um aus einem Minimum an Blech ein Maximum an Raum zu gewinnen, entschied sich Alec Issigonis, Konstrukteur der British Motor Corporation, kurz BMC, ein Auto mit Frontantrieb zu verwenden, so fiel schon einmal der Platz raubende Kardantunnel weg. Dann nahm er einen kleinen Vierzylinder und baute ihn quer in den Motorraum, heute völlig normal, damals ein revolutionärer Gedanke. Weil er das Viergang-Getriebe unter dem Motor platzierte, wurde die ganze Chose noch kompakter, so gewann Issigonis 50 Zentimeter Platz im Innenraum.

Damit nicht genug: Mickrige Zehn-Zoll-Räder verlangten nur nach kleinen Radhäusern, auch das sparte Raum. Der junge Ingenieur verlegte die Räder zudem an die Ecken der 3048 Millimeter kurzen und 1396 Millimeter breiten Karosserie. So gesehen haben wir ein bisschen übertrieben. Es war ein rund gelutschter Quader, kein Würfel und sie nannten ihn Mini.
Auftritt John Cooper
Was soll’s? Issigonis und ein gewisser John Cooper, der die frühe britische Verkörperung von „Pimp my Ride“ war, bearbeiteten die Führungsspitze bei BMC so lange, bis diese die Sportabteilung nötigte, sich näher damit zu befassen. In Abington nahe Oxford war man nicht gerade begeistert. Man hatte doch gerade erst den Austin Healey entwickelt, ein stämmiger Roadster mit langer Motorhaube, dickem Dreiliter-Motor und ordentlich Qualm auf den Hinterrädern.
Pat Moss war nicht nur die Schwester des legendären Stirling Moss, sie war auch so etwas wie die Michele Mouton der frühen Tage des Motorsports. Sie hatte mit dem Healey gerade ihren ersten Gesamtsieg geholt und nannte ihn das Schwein, weil man ihn angeblich wie ein Schwein treten musste, um die lange Nase mit dem Heck durch die Kurven zu dirigieren. Das war mal ein richtiges Rallyeauto, um den langweiligen Buckel-Volvos, Saab und Käfern den Schneid abzukaufen, aber der Mini? Vielleicht würde er ja ein brauchbares Trainingsauto abgeben.
Weil Issigonis so hartnäckig war, schickte man 1959 dennoch widerwillig drei Autos zur RAC-Rallye, in Zeiten vor der Erschaffung der Weltmeisterschaft das Finale zur Rallye-Europameisterschaft, dem höchsten Championat der späten 50er Jahre. Es war eine kurze Geschichte: Alle drei Minis fielen mit Kupplungsschäden aus, und man hätte es damit gut sein lassen können.
Tat man aber nicht. John Cooper pflanzte 1961 einen 997 Kubikzentimeter großen Motor ins Antriebsabteil, der in der Wettbewerbsversion immerhin schon 70 Rösser wiehern ließ. Während sich mancher noch fragte, ob es sittsam sei, ein so dickes Ding in so einer Hutschachtel zu versenken, hatte Cooper schon einen noch fetteren Apparat mit 1.071 Kubik und 92 PS am Start, eine wahre Höllenmaschine, denn das Gewicht des Cooper S lag bei lächerlichen 680 Kilogramm.
Ein Buchhalter als Sportchef
Der zweitwichtigste Schritt nach der Entwicklung des Mini Cooper war die Verpflichtung des früheren Buchhalters Stuart Turner als Sportchef. Turner sah mit seiner dicken Hornbrille nur aus wie ein langweiliger Zahlendreher, tatsächlich handelte es sich um einen der gewieftesten Rallye-Kenner aller Zeiten. Turner machte aus dem BMC-Team die erste wirklich professionelle Werksmannschaft. Ständig wurde entwickelt, getestet und wissenschaftlich geforscht, ein Umfeld, in dem sich Rauno Aaltonen sehr zu Hause fühlte.
Der Finne hatte schon Pokale mit allem errungen, was Motoren hatte, vom Speedboot über Speedway-Motorräder bis zu Formel-Autos. Aaltonen nannte man nicht umsonst den Rallye-Professor. Er erfand die später in Monte Carlo unerlässlichen Eisspione und war wie Turner und Beifahrer Tony Ambrose ein Pionier bei der Entwicklung des modernen Rallye-Aufschriebs. Es kam durchaus vor, dass BMC-Leute mit Studenten in Cambridge auf der Schulbank hockten, um sich über die Kommunikation in Flugzeugen zu unterhalten, um daraus im lärmenden Rallyeauto eine unmissverständliche Sprache zu entwickeln.
BMC macht keine halben Sachen
Damals waren Rallyes häufig noch untrainierbar, dennoch organisierte jedes Werksteam Service-Plätze, wo es nur ging und keines so durchdacht wie BMC. Den Fahrern standen bei einer Monte teilweise sieben verschiedene Winterreifen zur Wahl, das hatte sonst niemand. Auch kam vor der Turner-Truppe niemand auf den Gedanken, Rennreifen auf Asphalt-Prüfungen zu verwenden. Kurz: was man an Dampf im Motor nicht hatte, machte man durch Hirnschmalz wieder wett.
Bei näherem Hinsehen entpuppte sich die rote Kiste mit dem weißen Dach auch als gar nicht so übel. Mit etwas Mühe war der Mini immerhin so stabil zu kriegen, dass er eine Akropolis-Rallye gewinnen konnte. Nur tiefe Schlaglöcher mussten die Fahrer umkurven, weil die kleinen Räder nur eine geringe Bodenfreiheit erlaubten, abgesehen von den Gummi-Gelenken der Antriebswellen eine der wenigen Schwachstellen des Mini.
Er verfügte aber über Einzelradaufhängungen an allen vier Ecken, und zusammen mit den geringen Überhängen der mit Alu-Türen und Plexiglasfenstern zusätzlich erleichterten Karosserie, ergab das ein erstaunlich agiles Fahrverhalten. Auf Schnee und Schotter half die Frontlastigkeit mit guter Traktion, um ihm das lästige Untersteuern auszutreiben, erfand Rauno Aaltonen das Linksbremsen. Mit stehenden Hinterrädern und wühlender Vorderachse eilte der Mini plötzlich der Konkurrenz davon.
Der Sieg bei der Rallye Monte Carlo
Begünstigt wurde der in den seriennahen Gruppen eins und zwei homologierte David gegenüber den Goliaths auch vom Regelwerk. Anfang der sechziger Jahre war immer noch die Index-Wertung gebräuchlich. Hubraumschwache Autos mussten weniger schnelle Zeiten fahren als echte Sportwagen. Das Ganze wurde mit Faktoren umgerechnet und ergab am Ende ein Ergebnis, bei dem auch der Fünftschnellste plötzlich Gesamtsieger sein konnte. Danach krähte aber kein Hahn, als der fröhliche Ire Paddy Hopkirk 1964 die Rallye Monte Carlo gewann.
Plötzlich drehte man in Abington das ganz große Rad, und es kam noch besser. Kaum hatte der Cooper S seine ersten Gesamtsiege eingefahren, legte John Cooper mit einem auf nahezu obszöne 1.275 Kubikzentimeter aufgebohrten Motor noch eine Schippe drauf. 100 PS zerrten nun an den Antriebswellen, die schließlich durch metallene Verbindungsgelenke auch ihre Achilles-Ferse loswurden. Im Schneesturm der Rallye Monte Carlo 1965 brauchte man keine Index-Wertung zum Sieg. Ein Hinterwäldler aus Finnland fuhr in der Nacht der langen Messer drei von fünf Bestzeiten und siegte mit großem Abstand.
Man darf keine Mini-Geschichte erzählen, ohne kurz auf diesen baumlangen Finnen einzugehen, den im Vereinigten Königreich noch keine Sau kannte, so dass er bei seinem ersten Start bei der RAC von einem unwissenden Lokalreporter als Tim McKinnen kurzerhand eingeschottet wurde. Als der finnische BMC-Importeur 1962 auf eigene Kosten ein Flugticket nach England löste, um den in Wahrheit Timo Mäkinen getauften Hünen dem großen Stuart Turner vorzustellen, verzögerte sich die Begegnung noch ein Weilchen, weil der trinkfeste Timo als Erstes in eine Bar gelangte, aus der er auch nach mehreren Flaschen Champagner nicht mehr herausfand.
Naturtalent und Naturereignis
Am nächsten Tag musste er die Mechaniker anpumpen, um sich auslösen zu können und schon hatte er einen Stein im Brett. „Der ist einer von uns“, hatten die Schrauber gleich erkannt, obwohl er sich mangels Englisch kaum mit ihnen verständigen konnte. Mäkinen war ein Naturtalent und ein Naturereignis. Zusammen mit Landsmann Aaltonen räumte BMC reihenweise Gesamtsiege ab. Insgesamt waren es 18 und Aaltonen gewann mit fünf Saisonsiegen 1965 die Europameisterschaft.
Die Konkurrenz, die Veranstalter in Monte Carlo und die Sporthoheit in Paris waren die britische Alleinherrschaft längst satt, und so erschienen im Anhang J des Reglements für 1966 einige Passagen, die wie gemacht dazu waren, den Minis das Siegen unmöglich zu machen. Plötzlich waren zur Homologation 5.000 Serienautos nötig, statt bisher 1000. In diversen Klassen waren nur noch ganz seriennahe Gruppe-1-Autos siegfähig. Im zweiten Halbjahr 1965 wurde das Regelwerk noch drei Mal geändert, doch das nutzte alles nichts. Im Januar 66 waren 5047 Mini Cooper S montiert, die alles hatten, was als Basis für einen Monte-Sieger nötig war.
Prompt fuhren Aaltonen und Mäkinen erneut alles in Grund und Boden. Die technischen Kommissare bemängelten plötzlich, dass das Abblendlicht, das mit einem Widerstand anstatt mit einer Zweifaden-Glühlampe ausgestattet war, nicht den internationalen Autobahnvorschriften entspreche. Nur unter Vorbehalt durften die Cooper weiterfahren. Das finnische Duo holte in der finalen Nacht alle sechs Bestzeiten, danach krochen die Kommissare acht Stunden durch die kleinen Karossen. Die beiden Werks-Mini, die die anfängliche technische Abnahme zuvor anstandslos passiert hatten, wurden wie der drittplatzierte Lotus Cortina wegen regelwidriger Beleuchtung ausgeschlossen. Es siegte ein Citroen DS, einen größeren Skandal hat es in der Geschichte der Rallye Monte Carlo bis heute nicht gegeben.
Die Kommissare vs. Mini
Die Offensichtlichkeit, mit der man die Minis in diesem Jahr am Siegen hindern wollte, war grotesk. Bei der Tulpen-Rallye wurde der Engländer Tony Fall wegen eines fehlenden Luftfilter-Einsatzes aus der Wertung genommen. Dabei hatte er vorher erfolgreich um Erlaubnis gebeten, den Papierfilter zu entfernen. Paddy Hopkirk lag in Griechenland in Führung, als er eine Zeitstrafe wegen verbotenen Services in einer neutralen Zone kassierte. Zwar konnte er nachweisen, dass das entscheidende Schild von einem geparkten Auto verdeckt wurde, doch ließ sich der Veranstalter nicht erweichen.
Statt sich in den Schmollwinkel zurückzuziehen, schlug Turner zurück. 1967 gab es wieder ein neues Reglement, aber BMC war auch dafür präpariert. Mit fünf Gruppe-2-Werksautos reiste man nach Monte Carlo, um Rache zu nehmen. Mit Rennreifen schlug Aaltonen den Schweden Ove Andersson in seinem stärkeren Lancia Fulvia um zwölf Sekunden. Die BMC-Eisspione hatten zuvor aus ihren Serienautos die Teppiche gerissen, um die wenigen Eisflecken, die Aaltonen gefährlich werden konnten, von der Straße zu fegen.
Es war einer der größten Mini-Triumphe, aber auch einer der letzten. Zwar konnte Timo Mäkinen im gleichen Jahr zum dritten Mal in Folge die 1000-Seen-Rallye in Finnland gewinnen, obwohl ihm auf einer Prüfung die Motorhaube aufgesprungen war, und der Lenker aus dem Beifahrerfenster nach vorn schauen musste, aber die Zeit des Mini neigte sich nach einem halben Jahrzehnt rasant dem Ende zu.
Das Ende naht
Die Zeit der seriennahen Rallyeautos ging zu Ende. Die Käfer, Saab, Volvos und Minis hatten immer weniger Chancen gegen die kompromisslosen neuen Geräte vom Schlage eines Porsche 911 und einer Alpine. Als 1968 die Index-Wertung bei der Rallye Monte Carlo abgeschafft wurde, war auch der Bonus für die Kleinen futsch. Aaltonen wurde mit Ach und Krach Dritter.
Aaltonen und Mäkinen wanderten ab, und auch Stuart Turner ging. Bei BMC wurde das Sportprogramm stark beschnitten. Die Entwicklung des Austin 1800, der den Spitznamen „Landkrabbe“ trug, zeigte wenig Erfolg. Drei dieser 1800er krebsten erbärmlich durch Kenia. BMC war mittlerweile an den großen Mischkonzern British Leyland verkauft worden. Es gab noch ein Aufflackern mit dem Triumph TR7, doch auch der Mittelmotor-Sportwagen mit Achtzylinder war kein wirkliches Rallyeauto. Selbst der in den Achtzigern entworfene MG Metro, der mit seinen Minimalmaßen die Widerauferstehung des Mini darstellen sollte, war in der Gruppe-B-Version mit Allradantrieb nur ein Mitläufer gegen die aufgeladenen Geschosse von Lancia, Peugeot und Audi.
British Leyland war längst zerschlagen, BMW übernahm erst Rover und damit sich selbst, als man in München entschied, einen neuen Mini zu bauen. Der fesche Zwerg im Retro-Look wurde verkaufstechnisch sofort ein großer Erfolg, und das Rallyevolk sah den neuen Mini schon das Feld in der Junioren-WM für Fronttriebler mit 1,6-Liter-Saugmotor aufmischen, doch der Rover-Vierzylinder war als Sportmotor zu schwach, und die Marketing-Strategen ließen den Mini lieber mit Kompressor auf der Rundstrecke laufen. Eine Rallyeversion wurde nie homologiert.
Was das legendäre Original betrifft, waren Rauno Aaltonen und Timo Mäkinen nie die größten Fans des Mini Cooper, dennoch waren sie im Gegensatz zu ihrem Chef Stuart Turner fest davon überzeugt, dass die Ära des Zauberwürfels keineswegs in den späten Sechzigern hätte zu Ende sein müssen. Aaltonen dachte an einen V4-Motor mit 1,6 Litern, Mäkinen schwärmte gar von noch wüsterem Leichtbau, einem stärkeren Getriebe und einem bulligen V6. Aber das wäre eine andere Geschichte gewesen, die vom Wolf im Lämmchenpelz. Die aber wurde nie geschrieben.
TEXT Markus Stier
FOTOS BMW